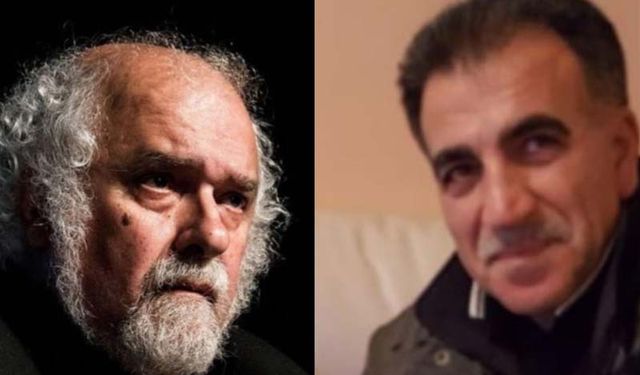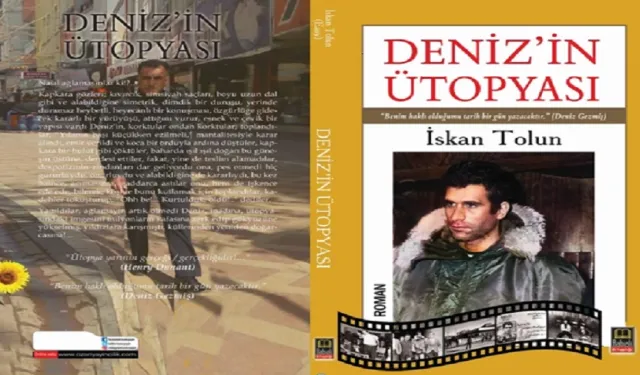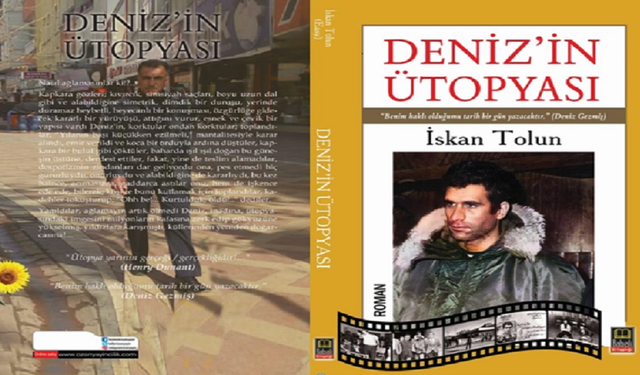Ein Gespräch über die Wahl des Integrationsrates am 13.09.20
Mit der Listenführerin und Sprecherin Lale Konuk
des Kölner Verbunds der Migrantenorganisationen KVMO
von Soné Gülyan
Frau Konuk, Sie sind in Köln meistens in kulturellen und mehrsprachigen Veranstaltungen unterwegs. Man sieht Sie dort regelmäßig entweder auf der Bühne als Moderatorin oder unter Künstler*innen als eine engagierte Veranstalterin. Bei den kommenden Wahlen betreten Sie erstmalig die politische Bühne und kandidieren für den Kölner Integrationsrat. Stellen Sie sich bitte vor und verraten uns, was Sie zu diesem Schritt bewegt hat.

Gerne… Man kennt mich gesamtstädtisch, als Kulturmanagerin und Veranstalterin in bestimmten Communities. Seit rund 30 Jahren bin ich im Theater-, Konzert-, Ausstellungs- oder auch Filmbereich aktiv. Ich war auch Mitbegründerin und bis 2010 Leiterin der Bühne der Kulturen/Arkadas-Theater, das heutige Urania-Theater in Ehrenfeld. In dieser Zeit habe ich dort Wurzeln geschlagen und war bis 2018 auch als Quartiersmanagerin in der sozialen Arbeit tätig, was viele nicht wissen. Die kulturelle Arbeit aber war und ist natürlich gesamtstädtisch. Ich finde den Austausch zwischen beiden Rheinseiten in der kulturellen, sozialen wie auch in der politischen Arbeit sehr wichtig. In meiner neuen Funktion – als Sprecherin des KVMO – sehe ich es als eines der wichtigen Aufgaben an, beide Rheinseiten noch stärker miteinander zu verbinden. Ich denke, dass Köln hier noch ein Defizit hat. Mit einer gelungenen Vernetzung kann man die Belange und die Interessen der rechtsrheinisch liegenden Migrantenorganisationen besser deutlich machen.
Ich trete in die Politik ein, weil ich durch meine soziale Arbeit in Ehrenfeld ein grundlegendes Wissen über gesellschaftliche Zusammenhänge erworben habe. Als Quartiersmanagerin habe ich mich für die Integration der aus Rumänien und Bulgarien eingewanderten Menschen eingesetzt, die oftmals keine richtige Wohnadresse hatten. Für die Lösung ihrer existenziellen Probleme musste ich beispielsweise Vereine aktivieren, und zu den städtischen Behörden eine Vernetzung herstellen. Es liegt mir sehr am Herzen, die Strukturen der meist ehrenamtlich geführten Vereine zu stärken. Ihre Arbeit wird meist nicht geschätzt, weil sie nicht wahrgenommen wird. Hier ist noch ein Nachholbedarf, den wir nicht mehr allein auf der Vernetzungsebene lösen können, sondern wir müssen uns auch auf der politischen Ebene bewegen, damit wir bessere Voraussetzungen dafür schaffen.
Ihre gesamtstädtische kulturelle Arbeit hat meistens einen interkulturellen Charakter. Kann man davon ausgehen, dass Sie sich mit unterschiedlichen Kulturen und ethnischen Gruppen sehr gut auskennen? Sie sind selbst auch Türkei-stämmig.
Ja, meine Eltern sind Anfang der 1960er Jahre aus Mittelanatolien ausgewandert. Ich gehöre praktisch zu der zweiten Generation der Gastarbeitergeschichte, die hier geboren und aufgewachsen ist. Aus meiner Erfahrung weiß ich, daß interkulturelle Kulturarbeit ein sehr essenzielles Mittel ist, um Grenzen zu überwinden und Ängste zu überwinden. Einen Austausch der Kulturen herzustellen, die Begegnung von Menschen aus unterschiedlichen Communities: darum geht es mir auch in dieser Arbeit, sei es durch Konzerte, Lesungen oder Theater- und Filmfestivals. Zum Beispiel veranstalten wir jährlich das Filmfestival „Tüpisch Türkisch“ und das Iranische Filmfestival. Auch in der Lutherkirche finden regelmäßig Konzerte und Festivitäten wie das Newrozfest „Frühling der Kulturen“ durch meine Kuration statt. Alle diese Aktivitäten sind überwiegend interkulturell und mehrsprachig.
Welche Kulturen und ethnischen Gruppen haben Sie durch Ihre Aktivitäten angesprochen bzw. miteinander verbunden?
Im Herbst letzten Jahres haben wir zum Beispiel erstmalig das Weltmusikfestival „Global Diffusion“ ins Leben gerufen. Ich übernahm die Koordination. In der Lutherkirche haben wir eine Musikveranstaltung organisiert, die wir „Schaufenster“ genannt haben. Da kamen anatolische, alevitische, armenische, kurdische, iranische Musiker*innen und Sänger*innen zusammen. So kam es zu einem interkulturellen Austausch, also der Communities und der Zuschauer*innen, so ähnlich wie bei unserem jährlichen Musikfest „Frühling der Kulturen“, dem klassischen Neujahrs-Fest der Iraner und der Kurden, dass am 21. März auch von vielen Armeniern und Aserbaidschanern gefeiert wird. Also, da sind sehr viele interkulturelle Aspekte drin. So kann man durch kulturübergreifende Aktivitäten Menschen zueinander bringen und ihre Neugierde auf das vermeintlich „Fremde“ wecken.
In dieser Arbeit haben Sie mit kulturinteressierten und bildungsnahen Menschen zu tun. Aber in Ehrenfeld, in Ihrer sozialen Arbeit, haben Sie eine andere Zielgruppe angesprochen – Einwanderer, die die deutsche Sprache kaum beherrschen, vielleicht sogar Analphabeten sind. Wie war Ihre Arbeit? Was haben Sie erfahren?
Das waren hauptsächlich Roma aus Bulgarien. Das Misstrauen bei diesen Menschen - also sagen wir mal gegenüber den deutschen Institutionen – ist sehr groß. Und anders herum auch. Da gab es eine große Diskrepanz in der gegenseitigen Wahrnehmung. Es war nicht leicht, sie mit Angeboten, so wie wir es kennen – seien es Sprachlern- oder Schulungsangebote – zu erreichen. Das war ein sehr schwieriger Prozess. Ich bin mit wenig Vorkenntnissen dort reingegangen, allerdings waren meine Voraussetzungen günstig, da ich sie mit meinen Türkisch-Kenntnissen ansprechen konnte. Bulgarische Roma sprechen auch türkisch. Das war für mich eine interessante Erfahrung, sich mit ihnen zu verständigen. Aber trotzdem ist eine Distanz geblieben; die Trennung durch die Erfahrung einer jahrhundertealten Diskriminierung ist geblieben, die sie als Gemeinschaft erlebt haben; diese kann man nicht einfach durch gut gemeinte Angebote überwinden.
Kann man sagen, dass diese Menschen Berührungsängste hatten, obwohl Sie auch türkischsprachig sind?
Ja, auch… diese konnten wir einigermaßen überwinden, weil ich einen bulgarischstämmigen türkischsprachigen Streetworker im Projekt hatte. So konnten wir zwar sprachliche Barrieren überwinden, aber trotzdem blieben tiefsitzende Ängste und Misstrauen erhalten. Das kann man nicht einfach mit einem Projekt auflösen. Das braucht Zeit und Vertrauen, aber das geht sehr langsam, bis sich die Lebensbedingungen verbessern. Die Erfolge sieht man, wenn die Kinder in die Schulen oder in die Kindergärten gehen. Da kann natürlich noch mehr passieren. Dafür muss man sehr eng mit den städtischen Behörden kooperieren, sie sensibilisieren. Das sind meine Erfahrungen aus meiner fünfjährigen Zeit als Quartiersmanagerin.
Sind diese Erfahrungen und Beobachtungen Ihre Motivation für die Politik?
Ja, das war eine grundlegende Erfahrung, die mich sehr bereichert und zum Betreten der politischen Bühne bewegt hat. Aber auch mein Studium als Diplom-Volkswirtin hat mich geprägt. Ich schaue mir die Dinge meist aus der Vogelperspektive an. Was kann man verändern? Welche Bausteine kann man verschieben oder verstärken, damit die Situation sich verbessert? Es reicht nicht allein, dass man soziale Arbeit macht oder kulturelle Aktivitäten veranstaltet. Diese erreichen immer ein gewisses Niveau. Ich denke, wir haben mehr Möglichkeiten, benachteiligte Menschen zu erreichen, wenn wir die Strukturen verbessern. Dafür müssen wir uns besser organisieren. Ein Netzwerk der Migrantenorganisationen wäre ein Mittel dafür. Dabei ist es mir wichtig, dass es sich nicht parteipolitisch definiert, sich nicht in die linke oder rechte Richtung bewegt oder durch ethnische Communities dominiert wird. Mir geht es darum, die Lebensqualität und Aufstiegschancen der Einwanderer an sich nochmal zu verbessern, indem wir ihre Organisationen professionalisieren und fördern. Das ist ein wichtiger Schlüssel, den besonders Köln mit seiner großen Vielfalt nutzen könnte, um sie für eine gesamtdeutsche und postmigrantische Gesellschaft zielgerecht zu aktivieren. Die Arbeit der Migrantenorganisationen wird aber nicht genügend wertgeschätzt und unterstützt, weil sie nicht wahrgenommen wird. Deswegen glaube ich, dass wir im Integrationsrat dafür unsere Stimme erheben müssen, um ihre Belange und Bedarfe auf der politischen Ebene deutlicher sichtbar und hörbar zu machen.
In Ihrem Wahlprogramm stehen Themen wie Antidiskriminierungsarbeit, Familie und Bildung, Sport und Kultur, die gleichberechtigte Teilhabe der Migranten und ihrer Organisationen. Wenn ich interpretieren darf, würde ich all diese Themen grundsätzlich zwei großen Arbeitsfeldern zuordnen: Aufklärung der benachteiligten, nichtdeutschen Bevölkerung und Partizipation für ihre Vertreter*innen bzw. Organisationen. Wie werden Sie dieses umfangreiche Programm in die Praxis umsetzen?
Unsere Liste besteht aus Mitgliedern der unterschiedlichsten Communities des KVMO (Kölner Verbund der Migrantenorganisationen). Dadurch haben wir sehr viel Wissen über Menschen, die nach Köln geflüchtet oder eingewandert sind. Wir sind auch gut vernetzt mit Fachexperten, die viel Praxiserfahrung haben. Wir haben Vereine, die sich speziell um geflüchtete Familien, sei es aus Afrika oder aus Syrien, kümmern. Wir haben eine Kollegin, die sich für Studenten aus Lateinamerika engagiert. Wir haben einen Vertreter der Sinti, der sich darüber beklagt, dass es institutionellen Rassismus gibt. Was ich damit sagen will: überall gibt es sichtbare und unsichtbare Diskriminierung und auch latenten Rassismus. Daher bin ich davon überzeugt, mit einer vielfältigen Vernetzung der Migrantenselbstorganisationen können wir relevante Probleme feststellen und entsprechende Lösungsvorschläge auf die politischen Ebenen einbringen, bzw. mit deren Vertretern und weiteren Fachexperten das Thema Integration ganz praktisch und lebensnah von unten aufarbeiten.
Der KVMO ist zugleich ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der sich aus Mitgliedern von Migrantenorganisationen aus verschiedensten Communities aus der Türkei, Griechenland, Afrika, Lateinamerika oder der Sinti zusammensetzt. Wir sind ziemlich jung, und wir beginnen erst jetzt mit der Arbeit. Wir wollen eine Plattform für diese Communities bilden, die in sich noch relativ geschlossen sind, die im Kultur-, Sport-, oder Sozialbereich aktiv sind. Mit ihren anerkannten Speakern wollen wir in Austausch treten und ihre Ideen und Bedarfe in die Politik fließen lassen. Das ist etwas, womit wir uns deutlich erkennbar machen und von den Parteiorganisationen absetzen.
In Ihrem Konzept haben Sie einen Schwerpunkt auf dem Thema „Familie und Bildung“. Das wird als Förderung der Mehrsprachigkeit formuliert. Möchten Sie darüber etwas sagen?
Ja, wir setzen uns für den Einsatz zusätzlicher Muttersprachen in KiTaS und Schulen ein, die insbesondere Flüchtlingsfamilien mitbringen und die möglichst gleich wertschätzend zur Anwendung kommen sollen. Es gibt zurzeit mehrere bilinguale Lernmethoden und unterschiedliche pädagogische Projekte in Kölner Schulen und Kindergärten. Diese sind aber zu wenig und abhängig von der Größe der Community, die diese Sprache spricht. Mehrsprachigkeit muss man auf jeden Fall mit innovativen Projekten weiter fördern – auch in den Stadtteilen, wo die Communities mehrheitlich vertreten sind. Das ist ein großer Bedarf, der noch nicht genügend abgedeckt ist.
Sie wollen sich auch für ein weiteres Thema – kultursensible Betreuung in der Bildung – einsetzen. Was können wir darunter verstehen?
Das ist ein sehr sensibles Feld. Da geht es um die Wahrnehmung und Interessen von Kinderrechten, aber auch von familiären Strukturen. Wenn eine, sagen wir mal, grob gesagt „deutsche Behörde“ dort hineinagiert, kommt es oft zu Missverständnissen und Konflikten. Da muss man die verschiedenen Interessen und Ziele gegeneinander abwägen, um Kinder und Jugendliche besser zu betreuen, ohne sie gleich aus der Familie zu reißen. Das Porzer „Interkulturelle Zentrum Solibund e.V.“ verfolgt hier sehr diffizile und verantwortungsvolle Projekte, wo auch immer wieder deutlich wird, wie wichtig es ist, dass sie als Fachexperten mit ihren kulturellen Hintergründen solche Projekte selbst durchführen, und dann im Anschluss aus ihrem Erfahrungsschatz heraus auch die Behörden sensibilisieren. Hier ist oft eine Diskrepanz zu beobachten. Wenn man nicht ein ausreichendes interkulturelles Wissen und ein Vertrauensverhältnis zu diesen Familien hat, kann man sie auch nicht angemessen betreuen. Man muss aktiv und gleichzeitig kultursensibel agieren und die Familien dabei mitnehmen. Gerade wurde ein neues Projekt von der Stadt Köln gestartet, die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Corona-Fällen. Das werden viele Familien als diskriminierenden oder rassistischen Akt wahrnehmen, wenn beispielsweise Kinder davon betroffen sind, die aus Kriegsgebieten kommen. Wie betreut man danach diese Kinder ohne Eltern, die schon durch ihre Fluchtgeschichte traumatisiert sind? Da geht es schnell um Erziehungswerte, die in Frage gestellt werden. Oder soll man diese Kinder aus ihren Familien rausreissen, weil ihre Erziehungswerte nicht den deutschen Erziehungswerten entsprechen? Man muss daher abwägen und schauen, was hilft dann letztendlich den Kindern und Familien.
Was möchten Sie zum Schluss über die Wahl des Integrationsrates sagen?
Dadurch, dass sich unsere Liste aus Vertretern der Migrantenselbstorganisationen bildet, erhöhen wir auch die Partizipation der Migrant*innen selber. Wir fordern Menschen auf zu wählen, die den Integrationsrat noch nie gewählt haben, weil sie darüber keine Kenntnis hatten oder ihn nicht wichtig genommen haben. Wir beteiligen uns in der Stadt auf der politischen Ebene, was auch in sich ein starker partizipativer Akt ist. Zwar hat der Integrationsrat nicht die Bedeutung, die ihm zustehen sollte, so haben wir dennoch die Chance, mehr Einfluss zu gewinnen, weil wir eine parteiunabhängige und von Migranten selbst organisierte Kulturen übergreifende Liste sind. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den anderen Listen und ein großer Schritt in Richtung gesellschaftliche Teilhabe. Daher sind wir bereit, die Belange und Interessen der in Köln lebenden Einwanderer zu vertreten.